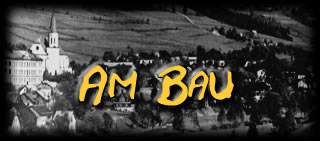>Laut
Urkunden aus dem Archiv der Schönburger zu Glauchau war der Meierhof des
Schönburgischen Amtes Greßlas
(Graslitz) nur als "Hof" bezeichnet worden.
Der Hof bestand aus einem Wohngebäude mit der Wohnung und der Amtsstube
des Gutsverwalters, einem Gesindehaus,
zwei Viehställen, einem Pferdestall mit 10 Boxen, einem Schafstall und
einem Backhaus. Nicht weit ab vom Silberbach
klapperte eine Mahlmühle, die nur "Mühle" genannt wurde
und mit einer Brettsäge kombiniert war.
Der Hof betrieb in der Hauptsache Milchwirtschaft, was durch die vielen Viehverkäufe
an die Fleischer
der Umgebung belegt ist. Zudem wurden viel Käse und Butter umgesetzt.
Die
Hofgebäude waren in ihren Fundamenten nicht isoliert, so dass die Stuben
und Kammern feucht waren. Der Glauchauer
"Hofmeister", der höchste Verwaltungsbeamte der Schönburger,
Herr Franz Poppa, musste bei seinen jährlichen Inspektionen
immer mehr neue Reparaturen anordnen. So war es schon im Jahre 1588 notwendig,
die Scheune zu erneuern, nachdem die Tenne
innerhalb von 12 Jahren viermal ausgewechselt worden war. 1616 wurden alle Gebäude
frisch untermauert, da der Holzschwamm
eine weitverbreitete Fäulnis herbeigeführt hatte. Durch diese vielen
Reparaturen verlor die Gräfin-Witwe die Freude an dem Hof und
verkaufte ihn im Jahr 1620.

Quelle:
Adolf Lienert: Silberbach - woher wir kommen, nichtvertriebene Erinnerungen
S. 302
Einst gab es auf der späteren Farbmühle ein barockes Wohngebäude
(Haus Nr. 80) sowie eine Schmelzhütte (Nr. 3). Dieses gräfliche Beamtenwohngebäude
und die Schmelzhütte gehörten dem Allodialherrn Graf Franz Anton von
Nostitz-Rhinek und wurde im Jahre seiner Fertigstellung (1771) samt der
dazu gehörenden Schmelzhütte an den Blaufarbenfabrikanten und Bürgermeister
von Platten Johann Josef Morbach verkauft.
Dieser
veränderte die zur Schmelzhütte gehörende Pochmühle so,
dass er Kobaltfarben herstellen konnte. Der Plattener hatte bereits zuhause
schon eine Blaufarbenerzeugung - die Silberbacher Farbmühle sollte als
Zweigniederlassung dienen. Silberbach bot mit kostenlosem Abraum
(Kobalt) der Eibenberger Kupferbergwerke, dem Vorhandensein einer Rollbeförderung
und mit Nutzungsmöglichkeit der Wasserkraft
den idealen Platz für eine Farbmühle.
Durch
die Schaffung der Farbmühle gewann ein Teil der arbeitslosen Messingwerksarbeiter
(Bau)
sowie andere Arbeitskräfte aus dem nahen Eibenberg eine neue Verdienstmöglichkeit.
Im
Jahre 1840 kaufte der Begründer des Silberbacher Blaudruckwerkes Am Bau,
Franz Poppa, die Farbmühle und vererbte sie seinem
Sohn Martin Poppa, einem gelernten Müllermeister. Anschließend wurde
die Farbmühle in eine Getreidemühle umgebaut.

Quelle der Geschichte von Neudorf: Graslitzer Nachrichten
- Einsendung Hilde Hamm
Neudorf
war die jüngste Gemeinde des Bezirkes Graslitz, wie schon der Name besagt.
Seine
Entstehung ist etwas umstritten. Wohl nur die Not der Kriegswirren, die Furcht,
das bißchen
Eigentum und Nutzvieh zu verlieren, hat die Leute auf den Gedanken gebracht,
sich hier
anzusiedeln und Zuflucht vor der in Graslitz vorherrschenden Pest zu finden.
Nach Hermann Brandl kaufte im Jahre 1632 ein Graslitzer Bürger (Rauh oder
Rauch) von dem
Heinrichsgrüner Richter Kühnl das Lehen "Zu Naißdorf".
Demnach war der erste Hausbesitzer
ein Graslitzer Bürger, während die Rodung und spätere Besiedlung
des Ortes wohl von Rothau
aus erfolgte. Neudorf hatte Ende der 20er Jahre 61 Häuser und eine Bevölkerung
von 395 Seelen,
und zwar 189 Männer und 206 Frauen, davon 22 Knaben und 32 Mädchen.
Flächenmäßig
war Neudorf mit seinen 965,2 ha die sechsgrößte Gemeinde, wovon allerdings
865,74 ha Waldbestand waren. Die restlichen Flächen entfielen auf Acker,
Wiesen, Weiden, Häuser
und Gärten. Die Bevölkerung war zu 3/4 in der Industrie, 1/4 in der
Landwirtschaft beschäftigt. Die
Fabriken in Graslitz und bis zu seiner Auflösung das Eisenwerk Rothau gaben
der Bevölkerung
Arbeit und Brot.
Für
den Wanderer war Neudorf ein lohnendes Ziel. Von Glasberg (813 m) kommend bot
sich eine
herrliche Aussicht: Tief unten das Tal des Silberbaches und an seinem südlichen
Ausgang das
Wahrzeichen der Stadt Graslitz, der Hausberg (712 m). In der Ferne die blauen
Höhen des
Kaiserwaldes und die Duppauer Berge und vor uns ragt ernst und düster der
Muckenbühl (949 m).
Ging man durch den Ort und den anschließenden Wald, von dem Neudorf ganz
umschlossen war, so
führte der Weg zum 991 m hohen Spitzberg. In sanfter Steigung ging der
Weg bergab und man merkte
es kaum, dass man den König des westlichen Erzgebirges erklomm.
Nun
ist Neudorf (Nová Ves) zu einem Ortsteil von Silberbach geworden. Die
ursprünglichen Häuser
existieren nicht mehr. Dafür ist nun aber eine Siedlung von Wochenendhäusern
vorhanden.

Quelle
der Geschichte von Nancy: Graslitzer Nachrichten - Einsendung Dr. A. Riedl
Die
ersten Ansätze Nancys sind in der Errichtung einer Glashütte am Oberlauf
des Silberbaches
durch die Brüder Josef und Ignaz Keylwerth aus Graslitz zu erblicken, welcher
die Erbauung eines Jagdschlosses durch den Grafen Friedrich Johann Chrysogon
Nostitz,
dem damaligen Besitzer der Allodialherrschaft Graslitz, folgte.
Die erste Nachricht vom Ortsteil Glashütte und dem Jagdschloß ist
in der Topographie von Graslitz
aus dem Jahre 1821 (geschrieben von Johann Florian Dotzauer) zu lesen:
Nordwärts
von Silberbach stand ehemals eine gutkonditionierte Josef und Ignaz Keylwerth
gehörige Glashütte mit 19 Häusern "Nancy, Glashütte"
genannt, worin gutes Tafelglas
erzeugt wurde. Aus Mangel an Holz mussten die Schlag- und Spielschleife sowie
die
Beleg- und Schneidmühle eingehen und die Gebäude verfallen.
Der Name
"auf der Glashütte" lebte bis 1945 noch fort, obwohl die Glashütte
seit 1812 aufgelassen war.
"Nancy"
allerdings war der Kosename der Anna Periez de Bourdett, die im Jahre 1795 die
Gemahlin des
Grafen Nostitz wurde. Ihr zu Ehren und zu Liebe hat der Graf das von ihm erbaute
Jagdschloß, die spätere
Försterei, Nancy genannt.

Quelle:
Graslitzer Nachrichten 1955 - Einsendung Adolf Lienert "Seltsame Flurnamen
der Heimat"
Die
Rolle zog sich vom fast gegen den Silberbach abfallenden Eibenberg bis zum Erzplatz
hin. Von dort
ging eine Untere Rolle zur Farbmühle hinab. In alter Zeit stand dort eine
Mühle, die blaue Farbe mahlte.
In der Doppelortschaft Eibenberg-Grünberg wurde im Schiefergestein Kupferkies
geschürft, daneben fand
sich Nickel, Wismut, Arsen und Kobalt. Mächtige Halden waren Zeugen der
alten Zeit. Auf dem Erzplatz
wurde das Erz umgeschlagen und der Kobalt in Rollwägelchen zur Farbmühle
hinabgerollt. Lange Jahre
stand auf dem Erzplatz ein schmiedeeisernes großes Martel, wenn ich nicht
irre, mit den vierzehn Nothelfern.

Quelle:
Adolf Lienert: Silberbach - woher wir kommen, nichtvertriebene Erinnerungen
S. 280
Die
Aufzeichnungen beginnen bei einem gewissen "Nikol Lausmann", dem 1618
zwölf Wiener Groschen für zwei
Laufkarren am Hof bezahlt wurden. Nikol ist der Stammvater des Hausnamens "Karrenhans".
Er wohnte in Eibenberg,
das damals Teil von Silberbach war. Der Hans baute dann im heutigen Ortsteil
"Karrenhansenhäuser". Jene Familien,
die sich Lausmann schreiben und Karrenhans heissen, wissen nunmehr, dass ihr
Urahne ein tüchtiger Handwerker
war. Im Bergbau hat man viele Karren verbraucht.

Quelle:
Adolf Lienert: Silberbach - woher wir kommen, nichtvertriebene Erinnerungen
S. 277
Über
die Entstehung dieser Ortsteile gibt es nur wenig zu erzählen. Sich in
Silberbach ansiedelnde Bauern
bevorzugten bei der Rodung sonnige Berge, windstille Winkel und helle Täler.
Nach ihrem Namen wurden ihre
Weile benannt: der Hiob hatte den Hobistenberg geräumt, der Matthias im
Matzenwinkel, der Tobias auf dem
Tobisenberg und der Peter im Peterwinkel. Der Baumatzengrund wurde von einem
Matz (Matthias) als erster
bezogen, der vordem am uralten Bau wohnte oder in einem Bau (Bergwerk) gearbeitet
hatte und darum der
Baumatz war.

Quelle:
Adolf Lienert: Silberbach - woher wir kommen, nichtvertriebene Erinnerungen
S. 277
Nach
der Rodung von Matzenwinkel, Peterwinkel und Gottelwenzelwinkel kamen die Bergleute
und
schürften und bohrten und pumpten, dass fast ein halbes Jahrhundert lang
der Lärm nicht nachließ
und der Plattenberg ringsherum von leichtfertig gebauten Stollen und wenig tiefen
Graben angezapft
war.
Manche
tiefe Keller alter Häuser waren aufgelassene Stollen. Im Berg tröpfelte
das Wasser stetig aus
allen Spalten. Wenn die Heuer im Stollen schürften, standen sie bald in
Wasserlachen. Sie befreiten
sich von dem Wasser durch Auspumpen. Längere Zeit standen die Pumpen im
unteren Teil des
Gottelwenzelwinkels. Es bürgerte sich ein, diesen Teil Pumpenwinkel (Pumpäwinkel,
Pumerwinkel, Bubnawinkel)
zu bezeichnen. Später wurde daraus der Name "Pumawinkel".